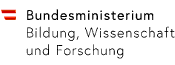Annual Climate Report
This content is available only in German language
Weather in retrospect for 2024
Jahr 2024: Wärmstes Jahr der Messgeschichte
2024 war in Österreich das mit Abstand wärmste Jahr der Messgeschichte. Im Tiefland Österreichs lag das Jahresmittel der Lufttemperatur um 1,8 °C und auf den Bergen um 1,9 °C über dem Mittel der ohnehin sehr warmen Klimaperiode 1991 bis 2020.
Zahlreiche Rekorde
2024 startete mit dem zweitwärmsten Winter der Messgeschichte und es folgten der wärmste Frühling und Sommer. Es gab nur wenige deutlich zu kühle Phasen, wie zum Beispiel Mitte September. Die Mehrzahl der Re-korde betrafen aber zu hohe Temperaturen. Zum Beispiel gab es an 100 der rund 290 Wetterstationen der Geo-Sphere Austria neue April-Höchsttemperaturen und an 30 Stationen neue September-Höchsttemperaturen. Eine neue Höchstzahl an Hitzetagen (mindestens 30 Grad) verzeichneten 2024 die Wetterstationen Wien Innere Stadt (52 Hitzetage), Eisenstadt (48), Wien Hohe Warte (45) und St. Pölten (42).
Extremer Regen und längere trockene Phasen
Die Niederschlagsmenge lag 2024 über die gesamte Fläche Österreichs gemittelt um acht Prozent über dem Durchschnitt. Es war damit eines der 30 niederschlagsreichsten Jahre in der 167-jährigen Niederschlagsmessreihe. Zu einem großen Teil ist dafür der extrem niederschlagsreiche September verantwortlich, der vor allem die Osthälfte verheerende Überschwemmungen brachte. Deutlich zu trocken waren Juli, August und November mit rund 21 %, 28 % bzw. 72 % weniger Niederschlag als im Durchschnitt.
Sehr lange Vegetationsperiode
Die hohen Temperaturen führten zu einer frühen Entwicklung der Pflanzen und zu einem späten Ende der Vegetationsperiode. Insgesamt war die Vegetationsperiode 2024 um zwei Wochen länger als in einem durchschnittlichen Jahr der Klimaperiode 1991-2020 und vier Wochen als in der Klimaperiode 1961-1990. Das ergibt Platz 7 in der 75-jährigen phänologischen Beobachtungsreihe. Auf Platz 1 bleibt das Jahr 2020 mit einer Abweichung von gut drei Wochen zum Durchschnitt 1991-2020 bzw. gut fünf 5 Wochen zu 1961-1990. Einige Frühlingspha-sen waren 2024 die frühesten der Messgeschichte. Die Marillenblüte beispielsweise war die früheste der gesamten Beobachtungsperiode von 1946 bis 2024 (2. März im Österreichmittel) mit einem Vorsprung von etwa drei Wochen gegenüber dem Mittel von 1991-2020 und vier Wochen gegenüber dem Mittel von 1961–1990. Die Blüte des Apfels, Flieders, Schwarzen Holunders und des Knäuelgrases sowie die Fruchtreife der Johannisbeere erreichten ebenfalls heuer ihre frühesten Eintrittstermine seit 1946.
Temperatur
Der Temperaturverlauf des Jahres 2024 hat in vielerlei Hinsicht alles bisher Dagewesene in der Messgeschichte Österreichs übertroffen. Einerseits sorgte das allgemein extrem hohe globale Temperaturniveau bundesweit für durchgängig deutlich zu warme Verhältnisse, andererseits waren kalte Luftmassen bringende Wetterlagen im Jahr 2024 unterrepräsentiert.
Alles in allem ergibt das für Österreich mit deutlichen Abstand das wärmste Jahr der Messgeschichte. An fast allen Stationen des Landes wurden neue Rekord der Jahresmitteltemperatur erreicht. Im Flächenmittel (HISTALP-Tiefland) ergibt das eine Abweichung zum Klimamittel 1991-2020 von +1,8 °C. Auch in den Gipfelregionen war es das wärmste Jahr und die Anomalien zum Klimamittel betragen hier +1,9 °C.
Der erste der insgesamt drei Monatsrekorde wurde schon im Februar gebrochen. Mit einer Abweichung zum Mittel 1991-2020 von +5,5 °C erreichte dieser Monat den bisherigen Höhepunkt in der Beobachtungsgeschichte Österreichs. Bisher hatte noch kein anderer Monat solch eine hohe Anomalie zum Klimamittel erzielt (bisher April 1800 Abw. +5,0 °C. Darauf folgte der wärmste März der Messgeschichte (Abw. +3,4 °C), der drittwärmste Juli (Abw. +2,1 °C) und der wärmste August (Abw. +3,0 °C). Aus dieser Abfolge an extrem warmen Monaten ergaben sich der zweitwärmste Winter (Dez 23 bis Feb 24) sowie der wärmste Frühling und wärmste Sommer. Die erste Aprilhälfte verlief ebenfalls extrem warm, was zur Folge hatte, dass an rund 100 Wetterstationen der GeoSphere Austria neue Apriltemperaturhöchstwerte gemessen wurden. Ähnlich verhielt es sich auch Anfang September. Bevor ein Kaltlufteinbruch im zweiten Monatsdrittel für eine markante Abkühlung sorgte, wurden an rund 30 Wetterstationen neue Monatsrekorde der Tageshöchsttemperaturen erzielt.
In der langen hochsommerlichen Phase von Mitte Juni bis Anfang September gab es keine markanten Kaltluftvorstöße, die das Temperaturniveau nachhaltig und für längere Zeit hätte senken können. Damit wurde die 30-°C-Marke sehr häufig überschritten und vor allem in den östlichen Landesteilen erreichten einige Wetterstationen neue Rekorde an Hitzetagen. In den außeralpinen Regionen Österreichs gab es zwei bis drei Hitzewellen, die durchschnittlich ein bis drei Wochen, stellenweise bis zu neun Wochen (Wiener Neustadt) außergewöhnlich lange andauerten.
Nach dem starken Temperaturrückgang Mitte September gab es nur noch vereinzelt, wie Anfang November, extrem hohe Temperaturen. Die überdurchschnittlich warmen Verhältnisse überwogen aber weiterhin und nur der September im Bergland und der November im Tiefland lieferten eine negative Monatsbilanz.
Die höchsten Temperaturabweichungen von 2,2 bis 2,4 °C traten in weiten Teilen Niederösterreichs sowie im Nordburgenland und im Innviertel auf. In Großteil des Landes lagen die Anomalien zwischen +1,7 und +2,2 °C. In Vorarlberg, im Tiroler Oberland, in Osttirol, im Pinzgau, im Pongau sowie in weiten Teilen Kärntens erreichten die Abweichungen zum Klimamittel 1991-2020 +1,1 bis 1,7 °C.
Klimatologische Einordnung der Lufttemperatur - Jahr 2024
(Histalp-Datensatz)
Tiefland:
Abweichung zum Mittel 1961-1990: +3,0 °C
Abweichung zum Mittel 1991-2020: +1,8 °C
Rang 1
Gipfelregionen
Abweichung zum Mittel 1961-1990: +3,1 °C
Abweichung zum Mittel 1991-2020: +1,9 °C
Rang 1
Extremwerte der Lufttemperatur im Jahr 2024
Höchste Lufttemperatur: Bad Deutsch-Altenburg (N, 169 m) 36.9 °C am 14. Aug
Tiefste Lufttemperatur (Berge): Brunnenkogel (T, 3437 m) -25.5 °C am 19. Jan
Tiefste Lufttemperatur bewohnter Ort: Schwarzau/Freiwald (N, 788 m) -21.1 °C am 9. Jan
Tiefste Lufttemperatur unter 1.000 m: Schwarzau/Freiwald (N, 788 m) -21.1 °C am 9. Jan
Lufttemperatur von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahresmittel und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Nauders (T, 1330 m) 6.4 °C Abw. +1.0 °C
St. Leonhard im Pitztal (T, 1454 m) 5.3 °C Abw. +1.3 °C
Bregenz (V, 424 m) 11.5 °C Abw. +1.3 °C
Windischgarsten (O, 600 m) 10.4 °C Abw. +2.4 °C
Hohe Wand (N, 937 m) 10.0 °C Abw. +2.4 °C
Eisenstadt (B, 184 m) 13.1 °C Abw. +2.3 °C
Niederschlag
Der Niederschlagszuwachs im Jahr 2024 war bis Mitte Juni in ganz Österreich meist durchschnittlich, oder lag wie im Nordwesten des Landes etwas darunter und im Süden und Westen stellenweise leicht darüber. Im Sommer dominierten in den nördlichen, östlichen und südöstlichen Landesteilen lange Trockenperioden, die von Starkregenereignissen unterbrochen wurden. Dies zeigte sich auch im Westen und Süden des Landes, war aber hier nicht so stark ausgeprägt. Die einzelnen sommerlichen relativ kleinräumigen Starkregenereignisse waren für zahlreiche Hagelschäden, Überflutungen und Hangrutschungen verantwortlich.
Mit dem Ende der hochsommerlichen Hitze in der ersten Septemberdekade erreichten erstmals seit Wochen wieder großräumige Tiefdrucksysteme, und damit wieder polare Kaltluft, Mitteleuropa. Einhergehend mit diesem Wetterumschwung entwickelte sich über dem Golf von Genua ein Tiefdrucksystem, das in weiterer Folge enorme Niederschlagsmengen über Österreich ablud. Die Folge waren stellenweise schwere Überschwemmungen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Nach Mitte Oktober dominierte herbstliches Hochdruckwetter und es war meist sehr niederschlagsarm. Erst ab Mitte Dezember nahm die Niederschlagstätigkeit wieder Fahrt auf.
Mit einer über die Fläche gemittelten Abweichung von 7 % gehört das Jahr 2024 zu einem der 30 niederschlagsreichsten Jahre in der 167-jährigen Niederschlagsmessgeschichte Österreichs. Den größten Beitrag lieferte dabei der extrem niederschlagsreiche September. Ein Beispiel für den Einfluss des September-Extremregens auf die Gesamtbilanz: In St. Pölten regnete es Mitte September innerhalb von fünf Tagen 409 mm. Das ist ein Großteil der Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen gesamten Jahres in St. Pölten (723 mm). Auch die Niederschlagsmengen im Mai lagen deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020. Deutlich zu trocken waren die beiden Sommermonate Juli und August, in denen im Flächenmittel um ein Viertel bis ein Drittel weniger Regen fiel. Mit einem Defizit von 71 % war der November ebenfalls besonders niederschlagsarm. Die restlichen Monate brachten, der statistischen Schwankung entsprechend, typische Niederschlagsmengen.
Im Westen und Nordwesten des Landes sowie in Teilen der Obersteiermark, im Nordburgenland und in weiten Teilen Niederösterreichs fiel überwiegend um 5 bis 25 % mehr Niederschlag als im Durchschnitt. Abweichungen zum Klimamittel von 25 bis 40 % gab es im Teilen des Wald- und Weinviertels und vom Dunkelsteiner Wald bis zu den nördlichen Ausläufern des Wienerwaldes. Mit bis zu 50 % mehr Niederschlag als in einem durchschnittlichen Jahr wurden im Tullner Becken und im Raum St. Pölten die höchsten Anomalien des Landes registriert.
Extremwerte des Niederschlags im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
nassester Ort: Loibl (K, 1097 m) 2728 mm Abw. 27%
trockenster Ort: Retz (N, 320 m) 541 mm Abw. 12% Niederschlagssumme von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Langenlebarn (N, 175 m) 969 mm Abw. 49%
St. Pölten (N, 274 m) 1049 mm Abw. 45%
Allentsteig (N, 599 m) 914 mm Abw. 43%
Aspang (N, 454 m) 755 mm Abw. -17%
Galtür (T, 1587 m) 858 mm Abw. -14%
Obertauern (S, 1772 m) 979 mm Abw. -12%
Sonne
Das Jahr 2024 war mit einer gemittelten Anomalie von -2 % etwa gleich sonnenarm wie das Jahr 2023. Die Abweichungen waren aber nicht gleichmäßig über das Bundesland verteilt. Im Südwesten, speziell in Osttirol und Oberkärnten sowie in Nordtirol entlang des Alpenhauptkammes war es mit Defiziten zum Klimamittel 1991-2020 von 10 bis 20 % besonders sonnenarm. In Vorarlberg, im restlichen Nordtirol, in Unterkärnten, im Lungau und in der Steiermark entlang der Niederen Tauern sowie im Flachgau und Teilen des Innviertels lagen die Anomalien zwischen -5 und 10 %. In den meisten verbleibenden Landesteilen entsprach die Sonnenausbeute dem Klimamittel (Abw. +/-5 %). Im südlichen Wiener Becken und im Nordburgenland schien die Sonne gegenüber dem vieljährigen Mittel um 5 bis 9 % länger.
Die sonnigsten Orte im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Unter 1000 m Seehöhe: Andau (B, 117 m) 2322 h Abw. 10%
Über 1000 m Seehöhe: Kanzelhöhe (K, 1520 m) 2103 h Abw. 2%
Sonnenscheindauer von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Seibersdorf (N, 185 m) 2154 h Abw. 10%
Wr. Neustadt (N, 275 m) 2067 h Abw. 10%
Andau (B, 117 m) 2322 h Abw. 10%
Obervellach (K, 688 m) 1479 h Abw. -19%
Spittal/Drau (K, 542 m) 1449 h Abw. -18%
Galzig (T, 2079 m) 1592 h Abw. -17%
Vorarlberg
Niederschlagsabweichung: 11%
Temperaturabweichung: +1.5 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -12%
Temperaturhöchstwert: Feldkirch (438 m) 34.1 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Lech (1442 m) -20.8 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Schoppernau (839 m) -15.0 °C am 20.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Feldkirch (438 m) 11.5 °C, Abw. +1.7 °C
höchste Sonnenscheindauer: Feldkirch (438 m) 1778 h, Abw. -6 %
Tirol
Niederschlagsabweichung: 6%
Temperaturabweichung: +1.7 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -10%
Temperaturhöchstwert: Innsbruck-Universität (578 m) 34.9 °C am 12.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Brunnenkogel (3437 m) -25.5 °C am 19.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Ehrwald (982 m) -16.3 °C am 13.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Innsbruck-Universität (578 m) 11.5 °C, Abw. +1.6 °C
höchste Sonnenscheindauer: Brunnenkogel (3437 m) 1959 h, Abw. k.A.
Salzburg
Niederschlagsabweichung: 5%
Temperaturabweichung: +1.8 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -3%
Temperaturhöchstwert: Golling (490 m) 35.2 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Sonnblick (3109 m) -22.8 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Radstadt (835 m) -18.5 °C am 26.12.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Salzburg/Freisaal (419 m) 11.5 °C, Abw. +1.8 °C
höchste Sonnenscheindauer: Salzburg-Flughafen (430 m) 1966 h, Abw. k.A.
Oberösterreich
Niederschlagsabweichung: 7%
Temperaturabweichung: +2.0 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 0%
Temperaturhöchstwert: Weyer (426 m) 35.6 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Dachstein-Gletscher (2520 m) -20.0 °C am 5.12.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Liebenau (845 m) -19.2 °C am 17.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Linz (262 m) 12.4 °C, Abw. +2.0 °C
höchste Sonnenscheindauer: Pabneukirchen (621 m) 2010 h, Abw. k.A.
Niederösterreich
Niederschlagsabweichung: 13%
Temperaturabweichung: +2.2 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 3%
Temperaturhöchstwert: Bad Deutsch-Altenburg (169 m) 36.9 °C am 14.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Jauerling (955 m) -13.7 °C am 9.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Schwarzau/Freiwald (788 m) -21.1 °C am 9.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Bad Deutsch-Altenburg (169 m) 13.1 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Schwechat (183 m) 2187 h, Abw. k.A.
Wien
Niederschlagsabweichung: 19%
Temperaturabweichung: +2.1 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 4%
Temperaturhöchstwert: Wien-Innere Stadt (177 m) 36.4 °C am 30.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Wien-Jubiläumswarte (450 m) -11.8 °C am 9.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Wien-Stammersdorf (191 m) -12.7 °C am 10.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Wien-Innere Stadt (177 m) 14.3 °C, Abw. +2.1 °C
höchste Sonnenscheindauer: Wien-Stammersdorf (191 m) 2150 h, Abw. k.A.
Burgenland
Niederschlagsabweichung: 11%
Temperaturabweichung: +2.1 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 6%
Temperaturhöchstwert: Andau (117 m) 36.3 °C am 10.7.
Temperaturtiefstwert: Bruckneudorf (166 m) -10.1 °C am 10.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Podersdorf (116 m) 13.2 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Andau (117 m) 2322 h, Abw. +10 %
Steiermark
Niederschlagsabweichung: 4%
Temperaturabweichung: +1.9 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 0%
Temperaturhöchstwert: Fürstenfeld (271 m) 35.6 °C am 17.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Stolzalpe (1291 m) -12.6 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Zeltweg (678 m) -16.5 °C am 21.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Bad Radkersburg (207 m) 12.4 °C, Abw. +2.0 °C
höchste Sonnenscheindauer: Bad Radkersburg (207 m) 2208 h, Abw. +7 %
Kärnten
Niederschlagsabweichung: 5%
Temperaturabweichung: +1.7 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -9%
Temperaturhöchstwert: Dellach/Drautal (628 m) 35.5 °C am 12.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Villacher Alpe (2117 m) -16.2 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Weitensfeld (704 m) -16.0 °C am 21.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Klagenfurt-HTL (441 m) 11.4 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Kanzelhöhe (1520 m) 2103 h, Abw. +2 %
2024 war in Österreich das mit Abstand wärmste Jahr der Messgeschichte. Im Tiefland Österreichs lag das Jahresmittel der Lufttemperatur um 1,8 °C und auf den Bergen um 1,9 °C über dem Mittel der ohnehin sehr warmen Klimaperiode 1991 bis 2020.
Zahlreiche Rekorde
2024 startete mit dem zweitwärmsten Winter der Messgeschichte und es folgten der wärmste Frühling und Sommer. Es gab nur wenige deutlich zu kühle Phasen, wie zum Beispiel Mitte September. Die Mehrzahl der Re-korde betrafen aber zu hohe Temperaturen. Zum Beispiel gab es an 100 der rund 290 Wetterstationen der Geo-Sphere Austria neue April-Höchsttemperaturen und an 30 Stationen neue September-Höchsttemperaturen. Eine neue Höchstzahl an Hitzetagen (mindestens 30 Grad) verzeichneten 2024 die Wetterstationen Wien Innere Stadt (52 Hitzetage), Eisenstadt (48), Wien Hohe Warte (45) und St. Pölten (42).
Extremer Regen und längere trockene Phasen
Die Niederschlagsmenge lag 2024 über die gesamte Fläche Österreichs gemittelt um acht Prozent über dem Durchschnitt. Es war damit eines der 30 niederschlagsreichsten Jahre in der 167-jährigen Niederschlagsmessreihe. Zu einem großen Teil ist dafür der extrem niederschlagsreiche September verantwortlich, der vor allem die Osthälfte verheerende Überschwemmungen brachte. Deutlich zu trocken waren Juli, August und November mit rund 21 %, 28 % bzw. 72 % weniger Niederschlag als im Durchschnitt.
Sehr lange Vegetationsperiode
Die hohen Temperaturen führten zu einer frühen Entwicklung der Pflanzen und zu einem späten Ende der Vegetationsperiode. Insgesamt war die Vegetationsperiode 2024 um zwei Wochen länger als in einem durchschnittlichen Jahr der Klimaperiode 1991-2020 und vier Wochen als in der Klimaperiode 1961-1990. Das ergibt Platz 7 in der 75-jährigen phänologischen Beobachtungsreihe. Auf Platz 1 bleibt das Jahr 2020 mit einer Abweichung von gut drei Wochen zum Durchschnitt 1991-2020 bzw. gut fünf 5 Wochen zu 1961-1990. Einige Frühlingspha-sen waren 2024 die frühesten der Messgeschichte. Die Marillenblüte beispielsweise war die früheste der gesamten Beobachtungsperiode von 1946 bis 2024 (2. März im Österreichmittel) mit einem Vorsprung von etwa drei Wochen gegenüber dem Mittel von 1991-2020 und vier Wochen gegenüber dem Mittel von 1961–1990. Die Blüte des Apfels, Flieders, Schwarzen Holunders und des Knäuelgrases sowie die Fruchtreife der Johannisbeere erreichten ebenfalls heuer ihre frühesten Eintrittstermine seit 1946.
Das Jahr 2024 im Detail
Temperatur
Der Temperaturverlauf des Jahres 2024 hat in vielerlei Hinsicht alles bisher Dagewesene in der Messgeschichte Österreichs übertroffen. Einerseits sorgte das allgemein extrem hohe globale Temperaturniveau bundesweit für durchgängig deutlich zu warme Verhältnisse, andererseits waren kalte Luftmassen bringende Wetterlagen im Jahr 2024 unterrepräsentiert.
Alles in allem ergibt das für Österreich mit deutlichen Abstand das wärmste Jahr der Messgeschichte. An fast allen Stationen des Landes wurden neue Rekord der Jahresmitteltemperatur erreicht. Im Flächenmittel (HISTALP-Tiefland) ergibt das eine Abweichung zum Klimamittel 1991-2020 von +1,8 °C. Auch in den Gipfelregionen war es das wärmste Jahr und die Anomalien zum Klimamittel betragen hier +1,9 °C.
Der erste der insgesamt drei Monatsrekorde wurde schon im Februar gebrochen. Mit einer Abweichung zum Mittel 1991-2020 von +5,5 °C erreichte dieser Monat den bisherigen Höhepunkt in der Beobachtungsgeschichte Österreichs. Bisher hatte noch kein anderer Monat solch eine hohe Anomalie zum Klimamittel erzielt (bisher April 1800 Abw. +5,0 °C. Darauf folgte der wärmste März der Messgeschichte (Abw. +3,4 °C), der drittwärmste Juli (Abw. +2,1 °C) und der wärmste August (Abw. +3,0 °C). Aus dieser Abfolge an extrem warmen Monaten ergaben sich der zweitwärmste Winter (Dez 23 bis Feb 24) sowie der wärmste Frühling und wärmste Sommer. Die erste Aprilhälfte verlief ebenfalls extrem warm, was zur Folge hatte, dass an rund 100 Wetterstationen der GeoSphere Austria neue Apriltemperaturhöchstwerte gemessen wurden. Ähnlich verhielt es sich auch Anfang September. Bevor ein Kaltlufteinbruch im zweiten Monatsdrittel für eine markante Abkühlung sorgte, wurden an rund 30 Wetterstationen neue Monatsrekorde der Tageshöchsttemperaturen erzielt.
In der langen hochsommerlichen Phase von Mitte Juni bis Anfang September gab es keine markanten Kaltluftvorstöße, die das Temperaturniveau nachhaltig und für längere Zeit hätte senken können. Damit wurde die 30-°C-Marke sehr häufig überschritten und vor allem in den östlichen Landesteilen erreichten einige Wetterstationen neue Rekorde an Hitzetagen. In den außeralpinen Regionen Österreichs gab es zwei bis drei Hitzewellen, die durchschnittlich ein bis drei Wochen, stellenweise bis zu neun Wochen (Wiener Neustadt) außergewöhnlich lange andauerten.
Nach dem starken Temperaturrückgang Mitte September gab es nur noch vereinzelt, wie Anfang November, extrem hohe Temperaturen. Die überdurchschnittlich warmen Verhältnisse überwogen aber weiterhin und nur der September im Bergland und der November im Tiefland lieferten eine negative Monatsbilanz.
Die höchsten Temperaturabweichungen von 2,2 bis 2,4 °C traten in weiten Teilen Niederösterreichs sowie im Nordburgenland und im Innviertel auf. In Großteil des Landes lagen die Anomalien zwischen +1,7 und +2,2 °C. In Vorarlberg, im Tiroler Oberland, in Osttirol, im Pinzgau, im Pongau sowie in weiten Teilen Kärntens erreichten die Abweichungen zum Klimamittel 1991-2020 +1,1 bis 1,7 °C.
Klimatologische Einordnung der Lufttemperatur - Jahr 2024
(Histalp-Datensatz)
Tiefland:
Abweichung zum Mittel 1961-1990: +3,0 °C
Abweichung zum Mittel 1991-2020: +1,8 °C
Rang 1
Gipfelregionen
Abweichung zum Mittel 1961-1990: +3,1 °C
Abweichung zum Mittel 1991-2020: +1,9 °C
Rang 1
Extremwerte der Lufttemperatur im Jahr 2024
Höchste Lufttemperatur: Bad Deutsch-Altenburg (N, 169 m) 36.9 °C am 14. Aug
Tiefste Lufttemperatur (Berge): Brunnenkogel (T, 3437 m) -25.5 °C am 19. Jan
Tiefste Lufttemperatur bewohnter Ort: Schwarzau/Freiwald (N, 788 m) -21.1 °C am 9. Jan
Tiefste Lufttemperatur unter 1.000 m: Schwarzau/Freiwald (N, 788 m) -21.1 °C am 9. Jan
Lufttemperatur von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahresmittel und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Nauders (T, 1330 m) 6.4 °C Abw. +1.0 °C
St. Leonhard im Pitztal (T, 1454 m) 5.3 °C Abw. +1.3 °C
Bregenz (V, 424 m) 11.5 °C Abw. +1.3 °C
Windischgarsten (O, 600 m) 10.4 °C Abw. +2.4 °C
Hohe Wand (N, 937 m) 10.0 °C Abw. +2.4 °C
Eisenstadt (B, 184 m) 13.1 °C Abw. +2.3 °C
Niederschlag
Der Niederschlagszuwachs im Jahr 2024 war bis Mitte Juni in ganz Österreich meist durchschnittlich, oder lag wie im Nordwesten des Landes etwas darunter und im Süden und Westen stellenweise leicht darüber. Im Sommer dominierten in den nördlichen, östlichen und südöstlichen Landesteilen lange Trockenperioden, die von Starkregenereignissen unterbrochen wurden. Dies zeigte sich auch im Westen und Süden des Landes, war aber hier nicht so stark ausgeprägt. Die einzelnen sommerlichen relativ kleinräumigen Starkregenereignisse waren für zahlreiche Hagelschäden, Überflutungen und Hangrutschungen verantwortlich.
Mit dem Ende der hochsommerlichen Hitze in der ersten Septemberdekade erreichten erstmals seit Wochen wieder großräumige Tiefdrucksysteme, und damit wieder polare Kaltluft, Mitteleuropa. Einhergehend mit diesem Wetterumschwung entwickelte sich über dem Golf von Genua ein Tiefdrucksystem, das in weiterer Folge enorme Niederschlagsmengen über Österreich ablud. Die Folge waren stellenweise schwere Überschwemmungen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Nach Mitte Oktober dominierte herbstliches Hochdruckwetter und es war meist sehr niederschlagsarm. Erst ab Mitte Dezember nahm die Niederschlagstätigkeit wieder Fahrt auf.
Mit einer über die Fläche gemittelten Abweichung von 7 % gehört das Jahr 2024 zu einem der 30 niederschlagsreichsten Jahre in der 167-jährigen Niederschlagsmessgeschichte Österreichs. Den größten Beitrag lieferte dabei der extrem niederschlagsreiche September. Ein Beispiel für den Einfluss des September-Extremregens auf die Gesamtbilanz: In St. Pölten regnete es Mitte September innerhalb von fünf Tagen 409 mm. Das ist ein Großteil der Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen gesamten Jahres in St. Pölten (723 mm). Auch die Niederschlagsmengen im Mai lagen deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020. Deutlich zu trocken waren die beiden Sommermonate Juli und August, in denen im Flächenmittel um ein Viertel bis ein Drittel weniger Regen fiel. Mit einem Defizit von 71 % war der November ebenfalls besonders niederschlagsarm. Die restlichen Monate brachten, der statistischen Schwankung entsprechend, typische Niederschlagsmengen.
Im Westen und Nordwesten des Landes sowie in Teilen der Obersteiermark, im Nordburgenland und in weiten Teilen Niederösterreichs fiel überwiegend um 5 bis 25 % mehr Niederschlag als im Durchschnitt. Abweichungen zum Klimamittel von 25 bis 40 % gab es im Teilen des Wald- und Weinviertels und vom Dunkelsteiner Wald bis zu den nördlichen Ausläufern des Wienerwaldes. Mit bis zu 50 % mehr Niederschlag als in einem durchschnittlichen Jahr wurden im Tullner Becken und im Raum St. Pölten die höchsten Anomalien des Landes registriert.
Extremwerte des Niederschlags im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
nassester Ort: Loibl (K, 1097 m) 2728 mm Abw. 27%
trockenster Ort: Retz (N, 320 m) 541 mm Abw. 12% Niederschlagssumme von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Langenlebarn (N, 175 m) 969 mm Abw. 49%
St. Pölten (N, 274 m) 1049 mm Abw. 45%
Allentsteig (N, 599 m) 914 mm Abw. 43%
Aspang (N, 454 m) 755 mm Abw. -17%
Galtür (T, 1587 m) 858 mm Abw. -14%
Obertauern (S, 1772 m) 979 mm Abw. -12%
Sonne
Das Jahr 2024 war mit einer gemittelten Anomalie von -2 % etwa gleich sonnenarm wie das Jahr 2023. Die Abweichungen waren aber nicht gleichmäßig über das Bundesland verteilt. Im Südwesten, speziell in Osttirol und Oberkärnten sowie in Nordtirol entlang des Alpenhauptkammes war es mit Defiziten zum Klimamittel 1991-2020 von 10 bis 20 % besonders sonnenarm. In Vorarlberg, im restlichen Nordtirol, in Unterkärnten, im Lungau und in der Steiermark entlang der Niederen Tauern sowie im Flachgau und Teilen des Innviertels lagen die Anomalien zwischen -5 und 10 %. In den meisten verbleibenden Landesteilen entsprach die Sonnenausbeute dem Klimamittel (Abw. +/-5 %). Im südlichen Wiener Becken und im Nordburgenland schien die Sonne gegenüber dem vieljährigen Mittel um 5 bis 9 % länger.
Die sonnigsten Orte im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Unter 1000 m Seehöhe: Andau (B, 117 m) 2322 h Abw. 10%
Über 1000 m Seehöhe: Kanzelhöhe (K, 1520 m) 2103 h Abw. 2%
Sonnenscheindauer von ausgewählten Wetterstationen im Jahr 2024
(Jahressumme und Abweichung zum Mittel 1991-2020)
Seibersdorf (N, 185 m) 2154 h Abw. 10%
Wr. Neustadt (N, 275 m) 2067 h Abw. 10%
Andau (B, 117 m) 2322 h Abw. 10%
Obervellach (K, 688 m) 1479 h Abw. -19%
Spittal/Drau (K, 542 m) 1449 h Abw. -18%
Galzig (T, 2079 m) 1592 h Abw. -17%
Jahr 2024: Übersicht Bundesländer
Vorarlberg
Niederschlagsabweichung: 11%
Temperaturabweichung: +1.5 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -12%
Temperaturhöchstwert: Feldkirch (438 m) 34.1 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Lech (1442 m) -20.8 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Schoppernau (839 m) -15.0 °C am 20.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Feldkirch (438 m) 11.5 °C, Abw. +1.7 °C
höchste Sonnenscheindauer: Feldkirch (438 m) 1778 h, Abw. -6 %
Tirol
Niederschlagsabweichung: 6%
Temperaturabweichung: +1.7 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -10%
Temperaturhöchstwert: Innsbruck-Universität (578 m) 34.9 °C am 12.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Brunnenkogel (3437 m) -25.5 °C am 19.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Ehrwald (982 m) -16.3 °C am 13.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Innsbruck-Universität (578 m) 11.5 °C, Abw. +1.6 °C
höchste Sonnenscheindauer: Brunnenkogel (3437 m) 1959 h, Abw. k.A.
Salzburg
Niederschlagsabweichung: 5%
Temperaturabweichung: +1.8 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -3%
Temperaturhöchstwert: Golling (490 m) 35.2 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Sonnblick (3109 m) -22.8 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Radstadt (835 m) -18.5 °C am 26.12.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Salzburg/Freisaal (419 m) 11.5 °C, Abw. +1.8 °C
höchste Sonnenscheindauer: Salzburg-Flughafen (430 m) 1966 h, Abw. k.A.
Oberösterreich
Niederschlagsabweichung: 7%
Temperaturabweichung: +2.0 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 0%
Temperaturhöchstwert: Weyer (426 m) 35.6 °C am 29.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Dachstein-Gletscher (2520 m) -20.0 °C am 5.12.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Liebenau (845 m) -19.2 °C am 17.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Linz (262 m) 12.4 °C, Abw. +2.0 °C
höchste Sonnenscheindauer: Pabneukirchen (621 m) 2010 h, Abw. k.A.
Niederösterreich
Niederschlagsabweichung: 13%
Temperaturabweichung: +2.2 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 3%
Temperaturhöchstwert: Bad Deutsch-Altenburg (169 m) 36.9 °C am 14.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Jauerling (955 m) -13.7 °C am 9.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Schwarzau/Freiwald (788 m) -21.1 °C am 9.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Bad Deutsch-Altenburg (169 m) 13.1 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Schwechat (183 m) 2187 h, Abw. k.A.
Wien
Niederschlagsabweichung: 19%
Temperaturabweichung: +2.1 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 4%
Temperaturhöchstwert: Wien-Innere Stadt (177 m) 36.4 °C am 30.6.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Wien-Jubiläumswarte (450 m) -11.8 °C am 9.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Wien-Stammersdorf (191 m) -12.7 °C am 10.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Wien-Innere Stadt (177 m) 14.3 °C, Abw. +2.1 °C
höchste Sonnenscheindauer: Wien-Stammersdorf (191 m) 2150 h, Abw. k.A.
Burgenland
Niederschlagsabweichung: 11%
Temperaturabweichung: +2.1 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 6%
Temperaturhöchstwert: Andau (117 m) 36.3 °C am 10.7.
Temperaturtiefstwert: Bruckneudorf (166 m) -10.1 °C am 10.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Podersdorf (116 m) 13.2 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Andau (117 m) 2322 h, Abw. +10 %
Steiermark
Niederschlagsabweichung: 4%
Temperaturabweichung: +1.9 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: 0%
Temperaturhöchstwert: Fürstenfeld (271 m) 35.6 °C am 17.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Stolzalpe (1291 m) -12.6 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Zeltweg (678 m) -16.5 °C am 21.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Bad Radkersburg (207 m) 12.4 °C, Abw. +2.0 °C
höchste Sonnenscheindauer: Bad Radkersburg (207 m) 2208 h, Abw. +7 %
Kärnten
Niederschlagsabweichung: 5%
Temperaturabweichung: +1.7 °C
Abweichung der Sonnenscheindauer: -9%
Temperaturhöchstwert: Dellach/Drautal (628 m) 35.5 °C am 12.8.
Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Villacher Alpe (2117 m) -16.2 °C am 20.1.
Temperaturtiefstwert unter 1000 m: Weitensfeld (704 m) -16.0 °C am 21.1.
höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Klagenfurt-HTL (441 m) 11.4 °C, Abw. k.A.
höchste Sonnenscheindauer: Kanzelhöhe (1520 m) 2103 h, Abw. +2 %
This information ist available as PDF document (Acrobat Reader) verfügbar:
Download of PDF document